Vater Rhein als Mutter Israels
Kassibert am von J. Isaksen. Lesezeit: ungefähr 47 Minuten. Kommentar mailen
Inhalt
- 1. Von Elefanten und Mäusen
- 2. Von Palästen und Murmeln
- 3. Von Freud und Leid
- 4. Vom Hier und vom Dort
- 5. Von Heimweh und Zuwendung
4. Vom Hier und vom Dort
VIERTE STATION Wie die Idee eines neuen rettenden Zions im Schatten des Doms entstand – nebst Banner, harter Währung und erklärter Treue zu Jerusalem am Rhein.
Max Isidor Bodenheimer ereilte die dunkel-helle Vision in der Richmodstraße Numero 6, just dort wo nach Kölner Sage tot gewähnte Gattinnen wandeln – und Pferde das Treppenhaus erklimmen. Wir schreiben das Jahr 1891, und seit knapp hundert Jahren dürfen wieder Juden in der Stadt sein. Die französischen Revolutionstruppen hatten die Bürgerrechte gebracht und der bald vierhundert Jahre währenden Vertreibung ein Ende gesetzt.
 Und ein Ruf erging an mich von der Höhe des Himmels und schrie mir in die Ohren: Rette mein Volk, dass es nicht sterbe!
Und ein Ruf erging an mich von der Höhe des Himmels und schrie mir in die Ohren: Rette mein Volk, dass es nicht sterbe!

Gedenktafel in der Richmodstraße am NeumarktWikimedia Commons
Was war los in der Stadt und im Lande, dass der Kölner Rechtsanwalt derart große Rettungsphantasien spann?
Während der Jahrhunderte der Verbannung durften sich keine Juden in Köln niederlassen. Als vereinzelter Händler war man vielleicht geduldet, weil in manchen Geschäften unabdingbar, aber zur Sperrstunde musste man aus der Stadt und über den Rhein. Die alte Judengasse am Rathaus war jetzt Tummelplatz der Kölner Bürgerschaft. Juden durften keine Häuser besitzen, durften sich nicht eintragen ins Stadtregister, in die Annalen der Stadt. Mit dem Schließen der Stadttore hatte man zu verschwinden, unsichtbar zu werden, aus dem Blick zu gehen, aus dem Sinn. Auch außerhalb der Stadt gab es keine Sicherheit, und deshalb zogen die Kölner Juden, der Spross Aschkenas – wie von Freud verinnerlicht und veröffentlicht – nach den Pestpogromen im 14. Jahrhundert und der endgültigen Austreibung 1424 gen Osten. Wer sich Pestkarten der Zeit anschaut, versteht warum: im Fluchtgebiet gab es keine Pest. Nicht dass es dort viel besser war, ja es war in vieler Hinsicht viel schlechter als am Rhein, aber nur da, wo das brodelne Gerücht der Brunnenvergiftung nicht ganz an die Oberfläche drang, konnte man bleiben – vorerst. Zudem wurden in Polen und Litauen bescheidene Privilegien gewährt. Mitgenommen hat man die Erinnerung an das rheinische Jerusalem, die deutsche Sprache und so manchen rheinischen Brauch. So wurden zu Jüdisch-Neujahr die Hosen- und Manteltaschen in ein fließendes Gewässer entleert; man entledigte sich symbolisch der drückenden Alltagssorgen. Ein Brauch vom Rhein, dem großen Strom, den man in die Welt hinaus trug – und der in der Folge als eigentümlicher jüdischer Brauch galt. Dabei war er gar nicht fremd, sondern inniges Heimweh nach sorgenfreien Zeiten an den Ufern des Rheins. Am Rhein selbst ist die Sitte längst verlorengegangen und lebt so nur weiter in der jüdischen Erinnerung an das rheinische Jerusalem.
Beirut - Rhineland (Heartland): Life, life is all right on the Rhine / No, but I know, but I know / I would have no where to go / No but there's nowhere to go, to go // Life, life is all right on the Rhine / No, but I know, but I know / I would have no where to go / No but there's nowhere to go, to go // Life, life is all right on the Rhine / No, but I know, but I know / Life, life is all right on the Rhine / No, but I know, but I know / I would have no where to go / No but there's nowhere to go, to go
Dann, längst in vorgeblich modernen Zeiten, brach im Osten eine Pest los, eine Pest der Gedanken, der man noch weniger entkam. Die Pogrome gegen die Juden wüteten erbarmungslos, und noch im 19. Jahrhundert konnte man über eine Million jüdischer Flüchtlinge verzeichnen. Jetzt ging es zurück gen Westen; vielen war die Neue Welt mit der Verheißung auf Glück und Wohlstand ein Ziel. Aber auch am Rhein bleiben viele der Gestrandeten hängen. 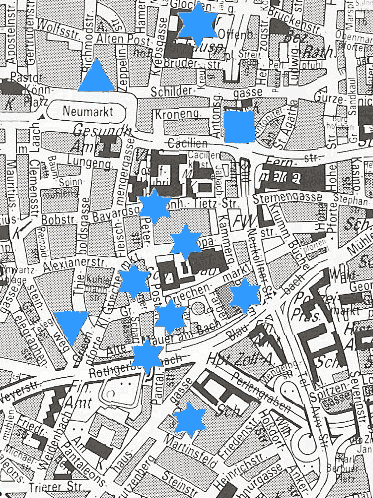 Max Bodenheimer und anderen gänzlich assimilierten Juden erscheinen die fremden und doch faszinierenden Brüder – wie es Kafka einmal ausdrückte – als Widerhall der eigenen, nicht mehr gelebten Geschichte: Altkölner Abkömmlinge, die am rheinischen Idiom der Austreibungszeit festgehalten hatten, mittlerweile durchsetzt von vielfältigen Einflüssen. Jiddisch, zuweilen befremdlich, aber unweigerlich als Deutsch zu erkennen. Südlich des Neumarkts, gar nicht weit von Bodenheimers Vision, finden sich viele der Flüchtlinge aus dem Osten wieder. Man zählte damals bis zu zehn kleine Synagogen und Gebetshäuser im Griechenmarktviertel (Abb.). Jeder halbwegs bedeutende Rebbe des Ostens hatte hier seine Anhänger. In der Synagoge der Assimilierten hingegen fühlte es sich wie in einem deutschen Gotteshaus an: vaterländische Treuegebete drangen aus der etablierten Gemeinde in der Glockengasse; ab 1899 sogar Orgelklänge aus der neuen liberalen Synagoge in der Roonstraße.
Max Bodenheimer und anderen gänzlich assimilierten Juden erscheinen die fremden und doch faszinierenden Brüder – wie es Kafka einmal ausdrückte – als Widerhall der eigenen, nicht mehr gelebten Geschichte: Altkölner Abkömmlinge, die am rheinischen Idiom der Austreibungszeit festgehalten hatten, mittlerweile durchsetzt von vielfältigen Einflüssen. Jiddisch, zuweilen befremdlich, aber unweigerlich als Deutsch zu erkennen. Südlich des Neumarkts, gar nicht weit von Bodenheimers Vision, finden sich viele der Flüchtlinge aus dem Osten wieder. Man zählte damals bis zu zehn kleine Synagogen und Gebetshäuser im Griechenmarktviertel (Abb.). Jeder halbwegs bedeutende Rebbe des Ostens hatte hier seine Anhänger. In der Synagoge der Assimilierten hingegen fühlte es sich wie in einem deutschen Gotteshaus an: vaterländische Treuegebete drangen aus der etablierten Gemeinde in der Glockengasse; ab 1899 sogar Orgelklänge aus der neuen liberalen Synagoge in der Roonstraße.
Wo aber sollten die armen Brüder aus dem Osten bleiben? Bodenheimer machte sich Gedanken, ein bisschen von oben herab, und formulierte 1891 in einer Schrift ganz ungeniert: Wohin mit den russischen Juden? Seine Rettungsidee orientierte sich am Kölner Vorreiter Moses Hess und versprengten Vertretern der jüdischen “Selbst-Emancipation” aus der Not des Ostens: Palästina, das alte Zion! Mit seinem Kölner Mitstreiter David Wolffsohn war Bodenheimer damit der tatkräftige Begründer der politischen Zions-Idee. Sicherlich, es gab in Wien einen Herzl, charismatisch und mit guten Kontakten, aber die beiden Kölner Soldaten – wie Herzl sie gerne nannte – waren die, die vor ihm da waren, und die die Sache voranbrachten. Man ging dabei ganz deutsch vor. Es wurde zunächst ein Verein gegründet, dann eine Bank, schließlich der zionistische Weltverband mit Sitz in der Richmodstraße. Ohne die Vorarbeit der Kölner sei sein Judenstaat nichts, erkannte Herzl. Als der deutsche Kaiser ins Heilige Land pilgert, reisen Herzl, Bodenheimer und Wolffsohn hinterher. Die Idee einer gesicherten und blühenden Judenheimat unter seinem Schutz erscheint dem Kaiser bei einer Audienz im Zelt vor Jerusalem wenig praktikabel: Wo man denn das lebenswichtige Wasser hernehmen wolle, zweifelt der Monarch. Die Herren der Achse Köln-Wien antworten recht unverblümt, der deutsche Jude sei zwischenzeitlich durchaus mit der Ingenieurskunst vertraut.
Der jüdische Rettungsplan der Domstädter sieht sich 1896 in den Kölner Thesen festgehalten und bildet später die Grundlage des ersten zionistischen Weltkongresses. Die erste Kölner These lautet:
 Durch gemeinsame Abstammung und Geschichte verbunden bilden die Juden aller Länder eine nationale Gemeinschaft. Die Betätigung vaterländischer Gesinnung und die Erfüllung der staatsbürgerlichen Pflichten seitens der Juden insbesondere der deutschen Juden für ihr deutsches Vaterland wird durch diese Überzeugung in keiner Weise beeinträchtigt.
Durch gemeinsame Abstammung und Geschichte verbunden bilden die Juden aller Länder eine nationale Gemeinschaft. Die Betätigung vaterländischer Gesinnung und die Erfüllung der staatsbürgerlichen Pflichten seitens der Juden insbesondere der deutschen Juden für ihr deutsches Vaterland wird durch diese Überzeugung in keiner Weise beeinträchtigt.
Es wird also sogleich präzisiert, dass man bei aller Sehnsucht nach Zion dem deutschen Vaterland weiterhin treu ergeben bleibe – als Deutscher, Kölner, Jude. Aber warum dann die Idee vom Fluchtort Palästina? In der zweiten Kölner These wird dies klar:
 Die staatsbürgerliche Emancipation der Juden innerhalb der anderen Völker hat, wie die Geschichte zeigt, nicht genügt, um die sociale und kulturelle Zukunft des jüdischen Stammes zu sichern, daher kann die endgültige Lösung der Judenfrage nur in der Bildung eines jüdischen Staates bestehen; denn nur dieser ist in der Lage die Juden als solche völkerrechtlich zu vertreten und diejenigen Juden aufzunehmen, die in ihrem Heimatland nicht bleiben können oder wollen. Der natürliche Mittelpunkt für diesen auf legalem Weg zu schaffenden Staat ist der historisch geweihte Boden Palästinas.
Die staatsbürgerliche Emancipation der Juden innerhalb der anderen Völker hat, wie die Geschichte zeigt, nicht genügt, um die sociale und kulturelle Zukunft des jüdischen Stammes zu sichern, daher kann die endgültige Lösung der Judenfrage nur in der Bildung eines jüdischen Staates bestehen; denn nur dieser ist in der Lage die Juden als solche völkerrechtlich zu vertreten und diejenigen Juden aufzunehmen, die in ihrem Heimatland nicht bleiben können oder wollen. Der natürliche Mittelpunkt für diesen auf legalem Weg zu schaffenden Staat ist der historisch geweihte Boden Palästinas.
Eine etwas angestaubte Diktion, die in deutschen Ohren heutzutage Unbehagen erzeugen mag, nicht zuletzt vor dem Hintergrund deutscher Scham, welche bisweilen mit großem Eifer ausgerechnet auf die staatgewordene Nachkommenschaft der Überlebenden umgeleitet wird – damals jedoch ein durchaus austarierter Gedankengang: Trotz staatsbürgerlicher Emanzipation werden wir als Juden noch ausgegrenzt. Es bleibt uns nichts, als uns auf diese zugewiesene wie neu zu entdeckende Identität zu besinnen. Wir brauchen Schutz, einen Ort, eine Vertretung. Nicht jeder Jude soll dorthin müssen, nur der vertriebene oder der, der aus freien Stücken will. Das Altneuland ist auf legalem Weg zu errichten, im Einklang mit bestehender Bevölkerung des Heiligen Landes, wie es an anderer Stelle heißt. Wir bleiben derweil gute Deutsche vom Rheine. Gezeichnet mit Zionsgruß, die nationaljüdische Vereinigung zu Köln.
Dass keine vierzig Jahre später Deutschlands systematisches Vernichten diesen Kölner Rettungsplan zu bitterer Bedeutung verhelfen würde, ist damals noch nicht zu ahnen. Die ins Café Runge auf der Hohe Straße eingeladene Rabbinerschaft setzt sich empört von den nationaljüdischen Visionären ab. Am Rhein liege die endgültige Heimat der Juden; die Rückkehr in das Zion der Bibel sei ein Hirngespinst, die Idee gemeingefährlich – deutsch-jüdischer, Kölner Hochverrat! Und sei dieser Moses Hess nicht Sozialist gewesen? Kurz: keiner der vorwiegend liberalen und treudeutschen Rabbiner ist zu gewinnen, nicht in der Stadt, und nicht im Reiche. Der visionäre Kaffeekranz sieht sich von den religiösen Führern geächtet. Dem Holzhändler Wolffsohn, selbst aus dem Osten stammend, gelingt es schließlich den orthodoxen Rabbiner Emanuel Carlebach für die Sache zu gewinnen. Carlebach war vor seiner Kölner Zeit in Memel tätig, und hatte bei seiner Arbeit dort erleben müssen, wie schutzlos die Juden waren. Der Kölner Carlebach interveniert bei der großen Rabbiner-Konferenz und erreicht mit einer brennenden Rede, dass die moderate deutsche Orthodoxie – als einzige damalige Glaubensausrichtung – die zionistische Idee nicht in Bausch und Bogen verwirft.
Israel kommt also vom Rheine her, wenn man so will. Auch die Fahne des modernen Israel wird ein halbes Jahrhundert vor der Staatsgründung hier in Köln entworfen; und der Schekel als Währung wird vor der Zeit hier gemünzt. Das Jerusalem am Rhein stiftet Alt-Jerusalem auf ein Neues. Und später dann ist es der Kölner Konrad Adenauer, der die deutsche Schuld bekennt, Wiedergutmachung gelobt, nicht nur in Worten dem Staat Israel Anteilnahme zuerkennt.
Inhalt
- 1. Von Elefanten und Mäusen
- 2. Von Palästen und Murmeln
- 3. Von Freud und Leid
- 4. Vom Hier und vom Dort
- 5. Von Heimweh und Zuwendung
